
Märchen in der Kita: Zauberhafte Geschichten bereichern den Kindergartenalltag
Märchen als Kulturgut und Teil der Kindheit

Märchen sind ein Schatz unserer Kultur. Viele Redewendungen und Alltagsphrasen haben ihren Ursprung in Märchen – man denke etwa an den Ausdruck vom „Dornröschenschlaf“ für jemanden, der sehr lange geschlafen hat, oder das sprichwörtliche Kulturgut „Spieglein, Spieglein an der Wand...“ aus Schneewittchen. Als Volksmärchen wurden diese Geschichten ursprünglich mündlich überliefert, lange bevor sie in Büchern standen. Sie sind voller Symbolik und Elemente, die generationsübergreifend verstanden werden: gute Feen und böse Hexen, mutige Prinzen und kluge Prinzessinnen, sprechende Tiere und magische Verwandlungen.
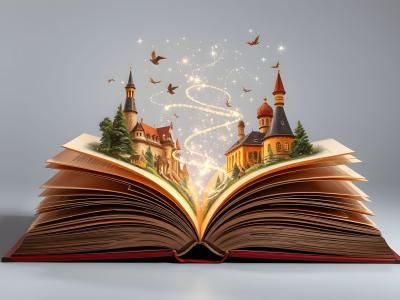
Für Kinder im Kindergartenalter üben solche Figuren und Erzählungen eine besondere Faszination aus. Ein Märchen beginnt fast immer mit den berühmten Worten „Es war einmal...“ – und schon öffnet sich für die Kinder die Tür zu einer anderen Welt. Diese Märchenwelt ist voller Wunder und Abenteuer, aber auch klarer Strukturen: Am Ende siegt das Gute, der Froschkönig wird zum Prinzen, Hänsel und Gretel entkommen der Hexe, und Rumpelstilzchen bekommt seine gerechte Strafe. Diese klaren Gegensätze von Gut und Böse und das glückliche Ende geben Kindern Orientierung und Hoffnung.
Warum Märchen im Kindergartenalltag so wertvoll sind

Die Frage stellt sich: Warum sollten Märchen einen festen Platz im Kindergartenalltag haben? Die Antwort liegt in den vielfältigen positiven Auswirkungen, die das regelmäßige Märchenerzählen auf die Entwicklung der Kinder hat. Märchen fördern die ganzheitliche Entwicklung der Kinder – sie sprechen Herz, Verstand und Fantasie gleichermaßen an. Hier einige wichtige Aspekte im Überblick:
SprachförderungMärchen sind hervorragende Sprachförderer. Beim Zuhören erweitern Kinder ganz nebenbei ihren Wortschatz – viele Wörter aus Märchen (etwa „Königreich“, „Zauberwald“, „Hexenküche“) klingen spannend und regen zum Nachfragen an. Die rhythmische, oft wiederholende Sprache der Märchentexte schult das Gefühl für Sprache und Melodie. Wenn Kinder Märchen mehrfach hören, beginnen sie oft, Passagen mitzusprechen oder nachzuerzählen. Dieses Nacherzählen stärkt die Erzähl- und Kommunikationsfähigkeit. Außerdem lernen Kinder berühmte Redewendungen oder Sprüche auswendig (z.B. „Knusper, knusper, kneischen...“ aus Hänsel und Gretel oder Zaubersprüche wie „Spieglein an der Wand...“), was ihre Aussprache und Merkfähigkeit fördert.
Fantasie und Kreativität
Märchen entführen Kinder in fantasievolle Welten und ermuntern sie, eigene innere Bilder zu entwickeln. Während sie gebannt lauschen, läuft in ihrem Kopf ein kleiner Film ab: Sie stellen sich den finsteren Wald, das verwunschene Schloss oder die sieben Zwerge bildlich vor. Diese imaginierten Bilder sind wertvoll für die geistige Entwicklung. Die Ideen der Kinder werden angeregt – nicht selten inspiriert ein Märchen die Kleinen später zum Malen, Basteln oder Rollenspiel. So fördert das Eintauchen in Märchen die Kreativität und die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, was (noch) nicht real ist.
Emotionale und Soziale Entwicklung
In Märchen werden grundlegende menschliche Gefühle und Konflikte behandelt: Angst, Mut, Neid, Güte, Gerechtigkeit. Kinder können sich mit den Helden identifizieren und erleben mit ihnen gemeinsam Gefühle wie Angst um Brüderchen und Schwesterchen (im gleichnamigen Märchen) oder Freude, wenn der Held siegt. Märchen bieten Gesprächsanlässe über moralische Werte: Was ist Gut und Böse? Warum soll man nicht lügen oder stehlen (Themen, die indirekt in vielen Märchen vorkommen)? Durch solche Gespräche im Anschluss lernen Kinder Werte wie Ehrlichkeit, Mut, Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit kennen. Auch Ängste können verarbeitet werden: Gruselige Märchenfiguren wie die Hexe oder der Wolf erlauben es Kindern, sich mit bedrohlichen Themen spielerisch auseinanderzusetzen. Wichtig ist, dass Märchen im sicheren Rahmen erzählt werden, damit die Kinder ihre Ängste in Geborgenheit überwinden können – in dem Wissen, dass am Ende das Gute gewinnt. Dieses Happy End vermittelt Kindergartenkindern Zuversicht und stärkt ihre emotionale Resilienz.
Konzentration und Zuhörkompetenz Märchen sind meist spannungsvoll aufgebaut – es gibt einen roten Faden, Höhepunkte und Lösungen. Wenn regelmäßig Märchen erzählt werden, lernen Kinder, über einen etwas längeren Zeitraum aufmerksam zuzuhören. Sie möchten wissen, wie die Geschichte ausgeht, und üben sich so in Geduld und Konzentration. Gerade in der heutigen hektischen Zeit, in der visuelle Medien oft kurze Aufmerksamkeitsspannen fördern, ist das traditionelle Zuhören eines erzählten Märchens eine wertvolle Übung. Die Kinder lernen, sich auf eine Erzählsituation einzulassen und still und gespannt der Stimme der Erzähler:in zu folgen. Diese Ruhe und Fokussierung wirken sich positiv auf weitere Lernsituationen aus.
Kulturelle Bildung
Märchen sind Teil unserer kulturellen Identität. Indem wir klassische Kindermärchen aus aller Welt (vor allem aber Grimms Volksmärchen in Deutschland) erzählen, vermitteln wir den Kindern auch kulturelles Wissen. Viele Märchenmotive wiederholen sich in Variationen in verschiedenen Kulturen. Märchen vermitteln zudem ein Gefühl für Tradition und Gemeinschaft – vielleicht kennen auch die Eltern noch die gleichen Geschichten aus ihrer eigenen Kindheit. Wenn Kinder das erleben, spüren sie Verbundenheit über Generationen hinweg. Ein Märchenprojekt in der Kita kann daher auch Eltern einbeziehen, indem sie eingeladen werden, Märchenstunden mitzugestalten oder ihr Lieblingsmärchen aus der eigenen Kindheit vorzustellen. So wird das Märchenerleben zu einem Brückenbauer zwischen Jung und Alt.
Erzählen statt Vorlesen – Die Kunst des Märchenerzählens

Beim Thema Märchen gibt es einen entscheidenden Trick: Erzählen Sie das Märchen möglichst frei, anstatt es nur vorzulesen! Das Vorlesen aus dem Buch hat zwar auch seinen Charme – insbesondere schöne Bilderbuchausgaben von Märchen ziehen Kinder optisch an –, doch das freie Erzählen bietet in der Praxis viele Vorteile. Es entsteht eine direktere Verbindung zwischen Erzähler:in und Zuhörer:innen. Warum ist freies Erzählen in der Kita so wirkungsvoll? Ein Vergleich zeigt die Unterschiede:
| Vorlesen (aus dem Buch) | Freies Erzählen (ohne Buch) |
| Blick häufig im Buch, wenig Blickkontakt zu den Kindern. | Intensiver Blickkontakt möglich – Erzähler:in kann Reaktionen der Kinder wahrnehmen. |
| Fester Wortlaut des Textes, wenig Flexibilität in Sprache und Tempo. | Flexible Gestaltung – Erzähler:in formuliert mit eigenen Worten und passt Tempo, Pausen und Lautstärke spontan an. |
| Kinder schauen auf Bilder im Buch, oft passive Rolle. | Kinder hören aktiv zu, stellen eher Fragen oder geben Kommentare ab; Erzähler:in kann auf Zwischenrufe eingehen. |
| Buch in der Hand bindet Gestik. | Freie Hände für Mimik und Gestik, was das Erzählen lebendiger macht. |
| Atmosphäre abhängig vom Buch (Illustrationen, Textlänge). | Lebendige Atmosphäre – Stimme, Gesichtsausdruck und Körpersprache der erzählenden Person wecken Spannung. |

Man sieht: Das Märchenerzählen ohne Buch ermöglicht es, flexibler auf die Kinder einzugehen. Durch Blickkontakt erhält die Erzählerin direkte Rückmeldungen – sie merkt sofort, ob die Kinder gebannt sind, ob jemand ängstlich wirkt oder ob Verständnisfragen auftauchen. Entsprechend kann sie das Märchen anpassen: vielleicht an einer spannenden Stelle eine kurze Pause machen, die Stimme senken, eine Szene deutlicher beschreiben oder eine Verständnisfrage der Kinder zulassen. Diese Interaktion wäre beim starren Vorlesen weniger natürlich möglich.

Natürlich erfordert freies Erzählen etwas Vorbereitung. Erzieher:innen sollten das Märchen vorab ein paar Mal lesen, um die Handlung sicher zu verinnerlichen. Wichtig ist, in der Sprache des Märchens zu bleiben – also ruhig altmodische Formulierungen wie „Es trug sich zu, dass…“ zu verwenden. Diese altbekannten Formeln tragen zur Atmosphäre bei. Man muss auch nicht jede Formulierung auswendig lernen; wichtiger sind, der roten Faden und die Schlüsselstellen. So kann beim Erzählen mit eigenen Worten nichts Wesentliches verloren gehen, und dennoch bleibt der ursprüngliche Märchenklang erhalten.
Praktische Tipps für zauberhafte Märchenstunden
Eine Märchenstunde in der Kita kann durch ein paar einfache Kniffe zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Hier sind praktische Tipps und Anregungen, damit das Märchenerzählen gelingt und alle Spaß daran haben:

1. Das richtige Märchen auswählen: Bei der Auswahl der Geschichte sollte man das Alter der Kinder berücksichtigen. Jüngere Kinder (unter 3 Jahren) verstehen oft besser kurze Geschichten oder Tiermärchen mit klaren Handlungssträngen. Kindergartenkindern ab 4 Jahren befindet sich im sogenannten „Märchenalter“ – sie lieben fantastische Geschichten mit Feen, Königen und Hexen. Für sie eignen sich klassische Grimm-Märchen wie Rotkäppchen, Frau Holle oder Der Froschkönig.
Wichtig ist, dass das Märchen altersgerecht aufbereitet wird: Sehr grausame oder komplexe Passagen kann man weicher formulieren oder auch einmal auslassen, ohne den Kern der Geschichte zu verlieren. Es muss außerdem nicht immer eine große Auswahl sein – Kinder hören oft lieber ein Lieblingsmärchen mehrfach, als ständig neue Geschichten präsentiert zu bekommen. Die Wiederholung desselben Märchens über Tage oder Wochen hinweg steigert die Vertrautheit und Begeisterung: Beim dritten oder vierten Mal kennen die Kinder schon die Namen der Figuren und rufen vielleicht den nächsten Handlungsschritt begeistert voraus. Diese Vertrautheit gibt Sicherheit und lässt eventuell anfangs gruselige Stellen ihren Schrecken verlieren, weil die Kinder schon wissen: Am Ende wird alles gut!

2. Atmosphäre schaffen – Ritual zum Einstieg: Beginnen Sie die Märchenstunde mit einem kleinen Ritual, um den Einstieg besonders zu gestalten. Das kann zum Beispiel ein „Märchenteppich“ sein, auf dem alle im Kreis Platz nehmen, oder eine Kerze, die nur zur Märchenzeit angezündet wird. Manche Erzieher:innen haben eine besondere Puppe oder ein Märchenbuch mit goldenem Einband, das zu Beginn feierlich geöffnet wird – auch wenn man nach dem Einstieg frei erzählt.
Ein gemeinsamer Anfangsspruch kann ebenfalls die Gruppe einstimmen (z.B. „Jetzt geht’s los, passt gut auf – das Märchen nimmt seinen Lauf...“). Solche Rituale signalisieren den Kindern: Wir betreten jetzt gemeinsam die Märchenwelt. Dadurch fällt es den Kindern leichter, zur Ruhe zu kommen und sich auf die Geschichte zu konzentrieren.

3. Lebendig erzählen – mit Mimik, Gestik und Stimme: Lebendiges Erzählen ist das A und O. Nutzen Sie Ihre Stimme wie ein Instrument: flüstern Sie geheimnisvoll, sprechen Sie mal extra langsam oder sehr schnell, je nachdem ob Spannung oder Auflösung nahe ist. Mit Gesten und Mimik können Sie Figuren darstellen – z.B. einen krummen Gang für die alte Hexe oder ausgebreitete Arme, um Größe zu zeigen („der Riese war so groß wie ein Haus!“). Die Kinder werden an Ihren Lippen hängen!
Blickkontakt nicht vergessen: Schauen Sie immer wieder in die Runde jeder einzelnen kleinen Zuhörer:innen. So merken Sie auch, ob alle folgen können oder ob jemand eine Pause oder kurze Erklärung braucht. Ermutigen Sie zwischendurch leise die Kinder, bei bekannten Stellen mitzumachen: Gemeinsam „Abrakadabra“ rufen oder den Zauberspruch aus dem Märchen aufsagen macht allen Spaß und hält die Aufmerksamkeit hoch.

4. Reaktionen der Kinder zulassen: Kinder erleben Märchen aktiv mit. Sie werden möglicherweise spontan lachen, erschrecken, Fragen stellen oder Zwischenrufe wie „Das stimmt doch gar nicht!“ äußern, wenn etwas Ungereimtes passiert. Solche Kommentare sind willkommen, zeigen sie doch, dass die Kinder mitdenken. Gehen Sie gelassen darauf ein: Eine kurze Klärung („Warum konnte der Frosch sprechen? – Weil es ein verzauberter Prinz ist.“) nimmt Zweifel und vertieft das Verständnis.
Allerdings sollte der Erzählfluss nicht zu oft unterbrochen werden – finden Sie eine Balance, bei der die Kommunikation mit den Kindern möglich ist, ohne dass die Spannung verloren geht. Oft genügt es, am Ende der Märchenstunde Raum für Fragen zu lassen, damit während der Geschichte die Aufmerksamkeit erhalten bleibt.

5. Materialien und Erzähldokumente einsetzen: Zusätzlich zum freien Erzählen können Materialien eingesetzt werden, um das Märchen noch fassbarer zu machen. Sehr beliebt sind Bildkarten, wie sie z.B. im Kamishibai-Erzähltheater genutzt werden: In einem Holzrahmen werden nacheinander große Bilder zum Märchen gezeigt, während Sie erzählen. Die Kinder haben dadurch visuelle Anhaltspunkte und verfolgen gebannt die Illustrationen.
Auch einfache Requisiten können wirkungsvoll sein: eine Krone, ein Schuh (für Aschenputtel), ein Topf und Löffel (für Suppenkasper-Verse) oder selbst gebastelte Fingerpuppen zu den Hauptfiguren. Solche Gegenstände ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und helfen besonders jüngeren Kindern, dem Geschehen zu folgen. Wichtig ist jedoch, die Bilder und Requisiten dosiert einzusetzen, damit die Kinder noch ihrer eigenen Fantasie folgen können und nicht von zu vielen Reizen abgelenkt werden.

6. Ausklang und Nachbereitung: Genauso wichtig wie der Einstieg ist ein ruhiger Ausklang der Märchenstunde. Direkt nach dem Erzählen kann eine kleine Ruhepause eingelegt werden – vielleicht hört ihr gemeinsam ein Lied, das zum Märchen passt, oder die Kinder kuscheln sich noch einen Moment still zusammen, um das Gehörte sacken zu lassen. Im Anschluss daran bieten sich kreative Aktivitäten als Projektverlängerung an: Zum Beispiel können die Kinder ein Bild zum Märchen malen oder ein Mandala mit Märchenmotiven ausmalen.
Auch ein gemeinsames Bastelangebot ist toll – etwa Bildkarten herstellen, indem jedes Kind seine Lieblingsszene malt, oder zusammen ein Märchenbuch basteln, in dem jede Seite ein Teil der Geschichte zeigt. Im Stuhlkreis können Rollenspiele stattfinden: Zwei Kinder spielen König und Königin, andere stellen die Tiere oder Zwerge dar. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass die Kinder ihre Eindrücke ausdrücken können – ob malerisch, spielerisch oder erzählerisch. Dadurch verarbeiten sie das Gehörte und lassen die Märchenwelt allmählich in die Realität zurückgleiten.

7. Eltern mit ins Boot holen: Märchen bieten eine wunderbare Gelegenheit, auch die Eltern einzubeziehen. Informieren Sie die Eltern darüber, welche Märchen in der Kita erzählt werden, und ermutigen Sie sie, diese vielleicht abends als Bett-Geschichte noch einmal zu Hause vorzulesen oder zu erzählen. Viele Eltern erinnern sich gerne an die eigenen Lieblingsmärchen – warum also nicht einen kleinen Eltern-Kind-Märchennachmittag veranstalten?
Die Kinder könnten ihren Eltern im Kindergarten stolz ein Lieblingsmärchen vorspielen oder man lädt einen Märchenerzähler ein. Elternabende zum Thema Märchen (mit Tipps, wie zu Hause erzählt werden kann) stärken zudem die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Kita und Familien. Wenn Kinder merken, dass Erzieher und Eltern in der Märchenwelt zu Hause sind, erleben sie eine durchgängige Wertschätzung dieses Themas – das motiviert sie umso mehr.
Kreative Projektideen rund ums Märchen








- Märchen-Woche oder Motto-Tag: Planen Sie eine Woche, in der jeden Tag ein anderes Märchen im Mittelpunkt steht. Die Räume können passend dekoriert werden (z.B. Wald-Atmosphäre für Rotkäppchen, Schloss für Dornröschen). Es gibt passende Aktivitäten: Am Hänsel und Gretel-Tag könnte man gemeinsam ein Lebkuchenhäuschen verzieren. Am Froschkönig-Tag basteln alle goldene Kugeln aus Alufolie. Ein Verkleidungstag als Abschluss, an dem alle als Märchenfigur kommen dürfen (ob als Prinzessin, Zwerg, Ritter oder Frosch), macht den Kindern besonderen Spaß. Solche Themenwochen schaffen intensive gemeinschaftliche Erlebnisse und lassen die Kinder tief in die Märchenwelt eintauchen.
- Märchenhaftes Theaterstück: Größere Kinder haben viel Freude daran, ein Märchen als kleines Theaterstück oder Puppenspiel einzustudieren. Gemeinsam mit den Erzieher:innen können sie Kulissen malen, einfache Kostüme aussuchen und natürlich proben. Klassiker wie Die Bremer Stadtmusikanten oder Schneewittchen und die sieben Zwerge eignen sich, weil sie mehrere Rollen bieten. Durch das Rollenspiel lernen Kinder, sich in andere Figuren hineinzuversetzen und stärken ganz nebenbei ihre sozialen Kompetenzen (Zusammenarbeit, Absprachen treffen) sowie Sprache und Auftreten. Eine Aufführung vor den anderen Gruppen oder den Eltern wird zum Höhepunkt – Applaus garantiert!
- Märchenhaftes Basteln und Malen: In der Praxis lassen sich Märchen wunderbar mit Kreativität verbinden. Jede Märchenfigur kann Anregung für ein Bastelangebot sein: Wie wäre es mit kleinen Zwergen aus Tannenzapfen und Filz? Oder Kronen basteln und mit „Edelsteinen“ bekleben, Zauberstäbe aus Holz und Glitzer, vielleicht auch ein selbstgemaltes großes Wandbild vom Lieblingsmärchen der Gruppe? Beim Basteln vertiefen sich die Kinder noch einmal ins Märchenthema, erzählen vielleicht ganz nebenbei die Handlung nach oder erfinden neue Varianten („Mein Prinz kann fliegen!“). Solche Aktivitäten fördern Feinmotorik und Fantasie gleichermaßen.
- Märchen-Bücher und Hörgeschichten erstellen: Ein weiteres Projekt kann sein, dass Kinder ihr eigenes Märchen erfinden. Gemeinsam sammelt die Gruppe Ideen – vielleicht mithilfe von Märchenmotiven auf Kärtchen (Prinz, Drache, Fee, Schatztruhe etc.). Die Kinder kombinieren die Elemente und denken sich eine eigene Geschichte aus, die die Erzieher:in aufschreibt. Daraus wird ein Gruppen-Märchenbuch mit Illustrationen der Kinder. Alternativ kann man ein einfaches Hörspiel aufnehmen: Die Kinder sprechen (oder babbeln) als Erzähler und Figuren, Geräusche werden mit einfachen Mitteln erzeugt. Das Ergebnis – eine Audio-CD oder Datei – können die Kinder mit nach Hause nehmen. So wird Kommunikation, narrative Kompetenz und Teamarbeit gefördert. Und wer weiß, vielleicht schlummert in der Gruppe ein kleiner Geschichtenerzähler oder eine Erzählerin, die dabei ihre Leidenschaft entdeckt!
Fazit: Märchenzauber im Kita-Alltag
Ob beim Vorlesen am Bett vor dem Mittagsschlaf oder beim freien Erzählen im Morgenkreis – Märchen in der Kita entfalten einen einzigartigen Zauber. Sie bereichern den Alltag, fördern wichtige Kompetenzen der Kinder und bereiten allen Beteiligten viel Spaß. Erzieher:innen haben mit Märchen ein wunderbares Werkzeug, um Bildung und Entwicklung der Kinder spielerisch zu unterstützen. Die leuchtenden Augen der Kinder, wenn sie gebannt einem Märchen lauschen, sprechen Bände. Wie der Dichter Herder einst treffend bemerkte: „Ein Kind, dem nie Märchen erzählt worden sind, wird ein Stück Feld in seinem Gemüt behalten, das in späteren Jahren nicht mehr angebaut werden kann.“ Märchen hinterlassen Spuren – positive, prägende Eindrücke, die ein Leben lang nachwirken können. In diesem Sinne: Öffnen wir gemeinsam das Tor zur Märchenwelt und lassen wir die Kinder staunen, träumen und lernen!